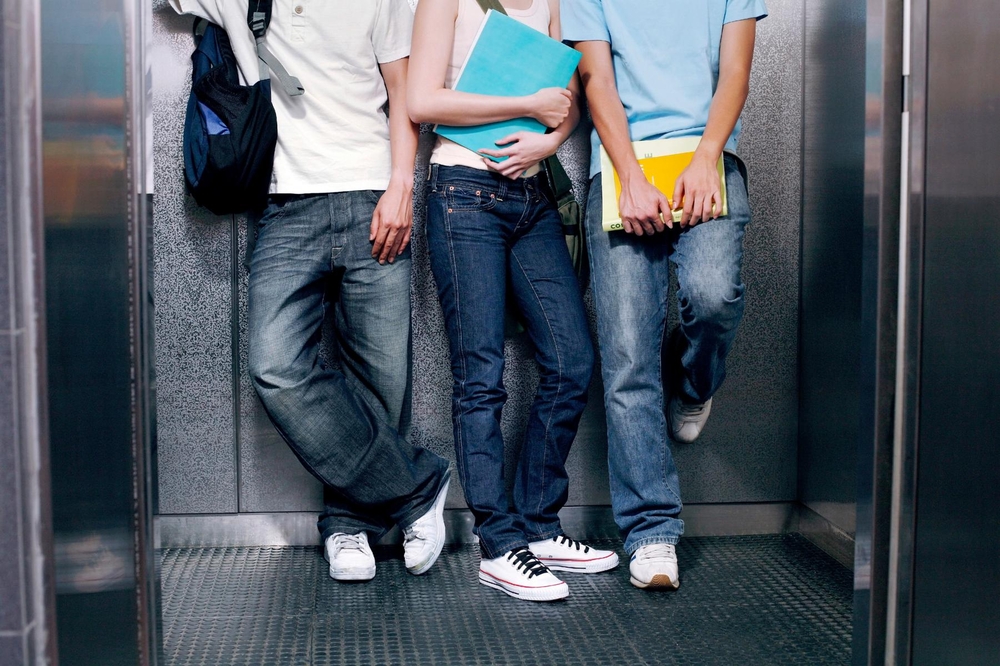Wo gehobelt wird, fallen Späne: Als eine der größten Industrienationen trägt Deutschland wesentlich zur Klimaerwärmung bei. Für rund 2 % der globalen Treibhausgasemissionen sind wir verantwortlich und gehören damit zu den Top 10 der Welt. Doch wir bessern uns, und das nicht erst seitdem eine grüne Partei an der Regierung beteiligt ist. Seit 1990 haben wir unseren CO2-Ausstoß durch verschiedene Maßnahmen zur Emissionsminderung um 40 % gesenkt, allein in 2020 um über 8 % gegenüber dem Vorjahr.
Heute sind wir beim Umweltschutz auf Attacke eingestellt und wollen europaweit eine Vorreiterrolle übernehmen, um dem gesetzten Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, Schritt für Schritt näher zu kommen.
Zu den größten CO2-Hauptverursachern in Deutschland zählen Gebäude: 16 % der gesamten Treibhausgasemissionen stammen 2021 aus diesem Sektor. Wird nicht nur der reine Betrieb der Gebäude berücksichtigt, sondern rechnet man auch die Emissionen vorgelagerter Prozesse wie die Herstellung von Baustoffen, die Baumaßnahme selbst oder die Erzeugung von Strom dazu, dann liegt der Anteil sogar bei etwa 30 %. Entsprechend groß ist der Hebel der Baubranche, die Folgen des Klimawandels abzubremsen. In der Folge ist die Klimawende ohne die Bauwende nicht zu schaffen. Dabei richtet sich der Blick automatisch auf den Neubau, wo durch ständig steigende energetische Mindeststandards mittelfristig klimaneutraler Wohnraum entstehen soll. Demnach werden sich die Klimaziele vergleichsweise einfach erreichen lassen. Oder etwa nicht?
Was vergessen wird: Jeder Neubau verbraucht Ressourcen. Noch bevor die ersten Bewohner einziehen, steckt das Projekt bei der Ökobilanz tief in den roten Zahlen, weil für die Errichtung des Gebäudes massenhaft graue Energie aufgewendet werden muss. Die Rohstoffgewinnung, die Herstellung der Baustoffe, ihr Transport zur Baustelle und mögliche vorangegangene Abriss- und Entsorgungsarbeiten können bei der Betrachtung des Gebäude-Lebenszyklus für den Großteil der gesamten Treibhausgas-Emissionen sorgen. Solange die benötigten Baumaterialien mit der „schmutzigen“ Energie aus Kohle, Erdgas und Kernkraft produziert werden, kann von einer ökologischen Bauweise nicht die Rede sein. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland einen Gebäudebestand, der deutlich in die Jahre gekommen ist. Rund 64 % der 22 Mio. Immobilien sind vor 1979 gebaut worden und aus energetischer Sicht unzureichend. Der Nachholbedarf ist enorm, doch ein Abriss ist die denkbar schlechteste Variante – ökobilanziell ist die Wiederverwendung der vorhandenen Materialien und somit der verbauten grauen Energie bei erhaltenswerter Bausubstanz sinnvoller. Nur durch einen wertschätzenden Umgang mit Fläche und Material lässt sich der C02-Ausstoß senken und das Bauen klimaneutraler gestalten.
Die Stimmen werden also laut, bei der energetischen Modernisierung in den Turbo-Gang zu schalten, auch wenn dafür teils umfangreiche und kostspielige Maßnahmen nötig sind. Umbauarbeiten, die sich für Investoren evtl. gar nicht rechnen oder aber für die Bewohner zum teuren Spaß werden. Um den Klimaschutz nicht gegen die Sozialverträglichkeit einzutauschen, ist der Gesetzgeber gefordert, den Altbau gegenüber dem Neubau wirtschaftlich konkurrenzfähiger zu machen. Statt mit unangekündigten, widersinnigen Förderstopps die Sanierungswilligen zu verunsichern und energieeffizientes Sanieren für Monate auszubremsen, sollten die Konditionen für das Bauen im Bestand noch attraktiver gestaltet werden.
Eine umfangreiche Sanierung ist aufwendig und birgt im Vergleich zum Neubau auf der grünen Wiese Planungsrisiken. Die Ökobilanz spricht jedoch für den Umbau, der nicht nur rohstoffbedingte Prozessemissionen einspart, sondern auch die Mobilitätsenergie für weite Wege zum abgelegenen Neubau. Somit muss bei der Gesamtstrategie zur Klimaneutralität dem Gebäudesektor unbedingt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
(Autor: Paul Deder)