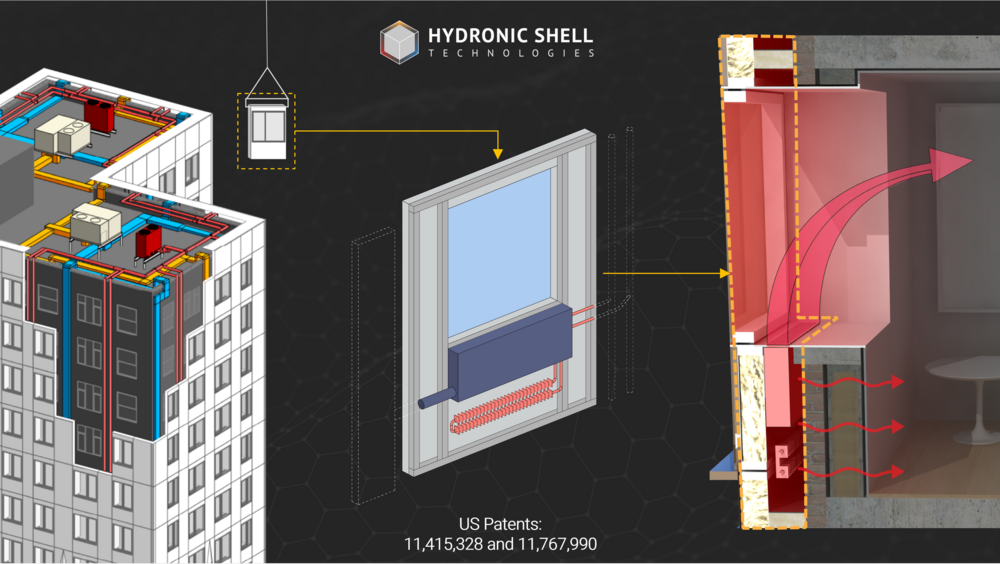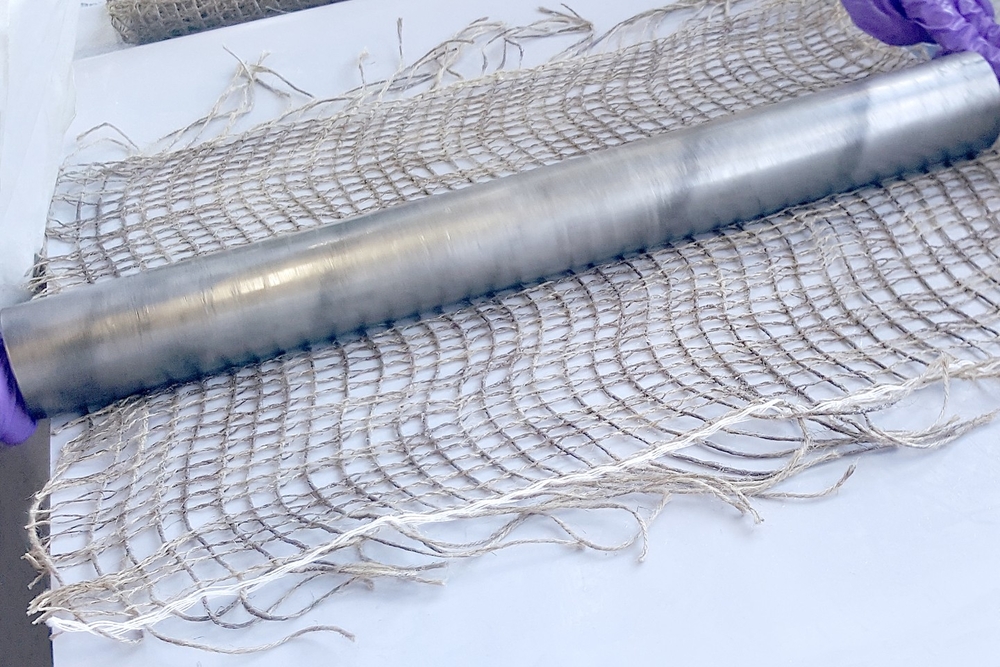Für das Bauen und Wohnen wird ein großer Anteil der verfügbaren Energie benötigt – mit Mineralölen, Gasen und Strom als Energielieferanten. Um den hohen Verbrauch im Sinne der Energiewende zu reduzieren, werden bei Neubauten oft hochtechnisierte Lösungen installiert. Diese Praxis wird jedoch mehr und mehr in Frage gestellt: Bietet die komplexe Haustechnik tatsächlich die geforderte Effizienz und den erwarteten Komfort für die Nutzer oder ist sie in Wahrheit kaum wirtschaftlich zu amortisieren und entwickelt sich für Bauherren im Laufe der Jahre schlicht zum teuren Hobby?
Zum einen werden nicht selten die theoretichen Verbrauchswerte der Anlagen im Betrieb nicht erreicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass die komplizierten Systeme im Alltag von Laien gesteuert werden. Zum anderen ist Hightech anfälliger für Fehler und Defekte, sodass sich der Wunsch nach Sorglosigkeit im neuen Haus schnell zu einer „never-ending story“ mit kostspieligen Reparaturen und permanenter Handwerker-Abhängigkeit umkehren kann. Daher wendet sich die Forschung inzwischen auch Lowtech-Häusern zu, um einen möglichst geringen Anteil an Haustechnik zu erreichen. Installiert werden dabei nur unbedingt notwendige Komponenten, der Rest wird baulich gelöst.
Um dem Nutzer mit einem Lowtech-Gebäude eine gleich hohe Lebensqualität bieten zu können, erfordern solche Projekte gerade in den frühen Phasen des Entwurfs eine besonders intelligente Planung. Die Gründe liegen auf der Hand: Werden bei einem Hightech-Gebäude im Zuge der Nutzung z. B. Defizite bei der Heiz- oder Klimaleistung festgestellt, lässt sich das Problem in der Regel durch Nachrüsten beseitigen. Bei einem technikreduzierten Haus ist das nicht ohne weiteres möglich.
Ein Beispiel für die gelungene Umsetzung der Lowtech-Idee ist das von Baumschlager Eberle Architekten entwickelte und eigengenutzte Bürogebäude 2226 im österreichischen Lustenau. Das Gebäude kommt ohne Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik aus und ist trotzdem in der Lage, den Nutzern komfortable Raumtemperaturen zwischen 22 und 26 °C zu bieten. Für die behagliche Wärme sorgt u. a. das anwesende Büropersonal selbst, da der menschliche Körper schon im Ruhezustand etwa 80 W Leistung erzeugt. Zudem wird die Abwärme von Computern, Kopierern und Beleuchtung sinnvoll genutzt. Für die notwendige Temperaturstabilität des Gebäudes sorgt die thermische Masse: als elementares Mittel der Architektur teilen sich die Außenwände in 38 cm statisches und 38 cm isolierendes Ziegelmauerwerk. Die massive Hülle nimmt tagsüber die Wärme auf, speichert sie und gibt sie nachts an den Innenraum wieder ab. Im Sommer reduzieren die tiefen Fensterlaibungen den Wärmeeintrag. Weil jeder Raum Außenwände in zwei Himmelsrichtungen besitzt, ist zudem stets eine Querlüftung möglich.
Fazit: Eine kritische Auseinandersetzung mit der Haus- und Anlagentechnik darf erlaubt sein, um Gebäude energieeffizient, ressourcenschonend und wirtschaftlich bauen und betreiben zu können. Mit den bewährten Mitteln der Architektur sind Spezialisten durchaus in der Lage, technikreduziertes Bauen mit hohem ökologischem Anspruch und langer Lebensdauer der Gebäude in Einklang zu bringen – und das ohne Komfortverzicht. Weniger ist manchmal mehr.
(Autor: Paul Deder)